Dossier „#unteilbar"
von Anna Spangenberg/Corinna Genschel - Klaus Dörre - Jürgen Reusch
März 2019
Vorbemerkung der Redaktion: Am 13. Oktober gingen in Berlin 240.000 Menschen für Solidarität und gegen Ausgrenzung auf die Straße: sie waren damit einem Aufruf des Bündnisses #unteilbar gefolgt. Angesicht des immer bedrohlicher erscheinenden Aufschwungs der politischen Rechten ...
Downloads
-
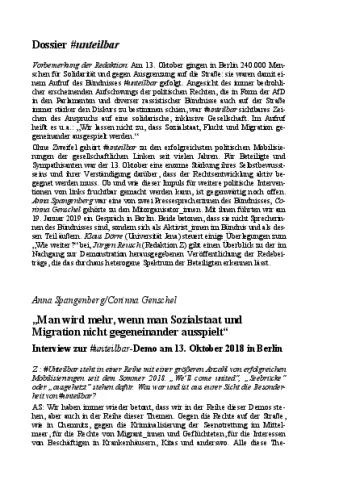 Dossier #unteilbar
Anna Spangenberg und Corinna Genschel / Klaus Dörre / Jürgen Reusch
Dossier #unteilbar
Anna Spangenberg und Corinna Genschel / Klaus Dörre / Jürgen Reusch